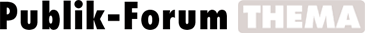Kinofilm »Quiet Life«
Groteskes Drama über die Asyl-Bürokratie

Kino. Der Blick in den Küchenschrank und in den Kochtopf auf dem Herd in der Wohnung von Sergej scheint die Inspektoren vollends zu überzeugen. Sie haben nur lobende Worte übrig für den russischen Flüchtling und seine Familie, und so scheint der Erteilung des unbegrenzten Aufenthaltsrechts in Schweden nichts im Wege zu stehen. Die beiden Töchter, perfekt integriert, überlegen sich bereits schwedische Namen.
Doch der Asylantrag wird abgelehnt, mit der Begründung, dass es keine überzeugenden Beweise für Sergejs politische Verfolgung in Russland gäbe: die Ausweisung steht bevor. Katia, die jüngste Tochter, fällt in einen komaähnlichen Zustand, bald darauf auch Alina. Um die beiden Mädchen im Krankenhaus besuchen zu dürfen, müssen die Eltern einen Kurs belegen, in dem sie lernen sollen, ihre Ängste wegzulächeln. Denn ihre Töchter, so die Ärztin, brauchen eine Atmosphäre der Sicherheit und Stabilität, um wieder aufzuwachen. Um ihre Kinder wiederzubekommen, müssen die Eltern schließlich einen radikalen Schritt machen.
Dieses kleine schwedische Drama spitzt anhand einer Vorzeige-Flüchtlingsfamilie das bürokratische Prozedere der Anerkennung von Asylsuchenden auf groteske Weise zu. Realer Hintergrund des Films ist das sogenannte Resignationssyndrom, das erstmals 1998 bei Kindern von Geflüchteten aus Osteuropa auftrat und als Reaktion auf die Belastungen des Migrationsprozesses diagnostiziert wurde. In kafkaesken Situationen, in denen Behördenangestellte emotionslos wie Roboter agieren, tritt die Unmenschlichkeit und Absurdität des Systems umso stärker zutage. Das Ringen zwischen Hoffnung und Verzweiflung im Kontrast zur distanzierten Inszenierung verleiht diesem Drama eine fast unerträgliche Spannung.
Quiet Life (Frankreich, Deutschland, Schweden, Estland, Griechenland, Finnland 2024). Film von Alexandros Avranas, 99 Min. Ab 12 J.