Bundesgerichtshof entscheidet über »Judensau«

Muss die »Judensau«, die Schmähskulptur an der Wittenberger Stadtkirche, entfernt werden? Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Ende Mai eine entsprechende Klage des jüdischen Aktivisten Michael Düllmann verhandelt. Düllmann hält die Sandsteinskulptur, die eine Sau zeigt, an deren Zitzen Juden saugen und in deren After ein Rabbiner schaut, für beleidigend; die Skulptur gehöre in ein Museum. Die evangelische Stadtkirche verweist dagegen auf eine 1988 unterhalb des Reliefs in den Boden gelassene Bronzetafel, die auf den antisemitischen Kontext hinweist und bekennt, der hier geschmähte Name Gottes sei »in sechs Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen« gestorben. Zwei Instanzen hatten der Kirche Recht gegeben. Das BGH-Urteil wird für den 14. Juni erwartet. In Deutschland gibt es rund 50 antijüdische Schmähskulpturen an und in christlichen Kirchen – vielerorts ohne jede Erklärung. Der Antisemitismusbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Christian Staffa, erklärte, dies dürfe keinesfalls so bleiben. Die Geschichte des kirchlichen Antijudaismus lasse sich aber »nicht ungeschehen machen, indem man ihre Zeugnisse abschlägt«. Ähnlich hatte sich auch Josef Schuster geäußert, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Friedrich Kramer, Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, und auch Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, plädieren dagegen für eine Entfernung der Skulptur.

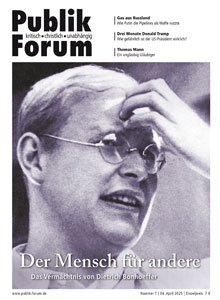

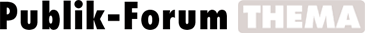
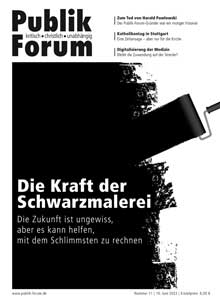


Leo Petersmann 22.07.2022:
Ich bin bestürzt, dass es immer noch etwa 50 solcher antisemitischer Plastiken in Deutschland an Kirchen gibt. Die Plastiken gehören an keine Kirche. Sie haben zu verschwinden, wie Hakenkreuze wo auch immer oder Hassbotschaften im Internet verschwinden müssen. Diese Plastiken sind Hassbotschaften. Ich halte es für sinnvoll und notwendig, dass an allen Stellen, wo sie entfernt wurden, eine Tafel darauf hinweist und zum Ausdruck bringt: die Bestürzung über den viele Jahrhunderte langen Judenhass in der Kirche; die entschlossene Abkehr davon, weil er mit der Ausrichtung an Jesus unvereinbar ist; die tiefe Verneigung vor den Opfern dieser schrecklichen kirchlichen Gewalt.
Henning Kaufmann 22.07.2022:
Da hat man uns nach dem Ende des »Dritten Reiches« gesagt: Wir müssen aus der Geschichte lernen! Wie aber, wenn wir die Mahnmale, die uns die Geschichte hinterlässt, aus dem öffentlichen Bewusstsein entfernen und in die Museen einsperren? Unsere Geschichte hat unsere Kultur beeinflusst und ist Teil unserer Identität in einer multikulturellen Gesellschaft. Das kann man nicht in einem »Giftschrank« verstecken, und man sollte es auch nicht. Denn genau dadurch haben die Geschichtsvergessenen vom Schlage der »Reichsbürger« leichtes Spiel, wenn sie versuchen, die unangenehmen Seiten der eigenen Geschichte auszublenden.
Charlotte Horn 22.07.2022:
Auch ich habe bisher diese Haltung vertreten: Die »Judensau« und andere antijudaistische Darstellungen soll man zur Aufarbeitung der unsäglichen Geschichte christlichen Judenhasses nutzen. Aber ich stelle das inzwischen infrage. Ist das nicht Täterperspektive? Gegenfrage: Wäre irgendwo in einem Kriegsgebiet die Vergewaltigung einer Frau durch Soldaten verherrlichend dargestellt, würde man dann nach dem Krieg, wenn Frieden eingekehrt ist, tatsächlich entscheiden können: »Zur Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen stellen wir nun einige Erklärtafeln auf. Im Übrigen ist es euch Frauen zumutbar, diese gemalten Szenen beim Vorbeilaufen jedes Mal anzusehen?«