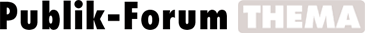Weihnachtserlebnisse
Und dann kam es anders

Ganz in meiner Zerbrechlichkeit
Im damals neu gegründeten offenen Kloster Abbaye de Fontaine-André in Neuchâtel in der Schweiz laden wir 1994 zu »Weihnachten für Alleinstehende« ein. Viele Alleinstehende kommen, gebückt durch die Härte des Lebens. Suchende Menschen, die Mühe haben, zu ihrer jetzigen Lebenssituation zu stehen: Scheidung, Magersucht, Insolvenz, Trauer über ein verlorenes Kind... Ich selbst habe eine zweijährige Burn-Out-Zeit hinter mir, in der ich monatelang keinen Gottesdienst feiern und besuchen konnte. Unser Meditationsraum ist schlicht-festlich geschmückt. Wenige Minuten vor dem Beginn unserer Heiligabendfeier entdecken wir, dass im Stall drei Lämmer auf die Welt gekommen sind. Spontan entscheiden wir, unseren Gottesdienst im Stall zu feiern. Wir lassen alles liegen und nehmen »nur« uns selbst mit!
Wir sind geborgen im Stall, mit wenig Licht, damit wir auch unsere Dunkelheit umarmen können, Vertrauensworten aus dem Lukasevangelium, Brot und Wein, all-EINS mit Menschen weltweit, Tieren, Schöpfung und Kosmos.
Beim Brechen des Brotes bin ich so bewegt, dass mir – wie die Monate – zuvor fast die Worte ausgehen. Existenziell berührt mich die Zusage, ganz zu sein, in meiner Verlorenheit, meinem Verwundetsein, meiner Zerbrechlichkeit: Bethlehem hier und jetzt!
Seit jener Weihnachtsfeier höre ich jeden Tag schon am Frühstückstisch beim Brechen des Brotes jene zeitlosen Worte eines menschgewordenen Gottes, der uns liebevoll zuspricht: »Ich bin da, sei auch du heute ganz da, kraftvoll-zerbrechlich, lebensfroh-weinend, kämpferisch-gelassen, segnend-heilend.«
Pierre Stutz, Schweizer Theologe, lebt mit seinem Lebensgefährten in Osnabrück.
Krippe ohne Jesus
Im Jahr 1983 bezog ich mit vier anderen Franziskanern unterschiedlicher Nationalität eine altes Haus in Nairobi. Als es Advent wurde, überlegten wir: »Wie feiern wir Weihnachten?« Bruder Francesco Salgado bot sich an, das Wohnzimmer weihnachtlich zu dekorieren: Die Holztrage im offenen Kamin verwandelte er mit Holzwolle in eine Krippe. Aber ein Jesuskind war in Kenias Hauptstadt nicht zu finden. So legte er stattdessen eine Postkarte von Greccio mit dem weinenden Franziskus in die Krippe. Dazu die Worte: »Jesus is not here! He is in your heart!« (Jesus ist nicht hier. Er ist in deinem Herzen!) Wir bewunderten seine Kreativität und waren zufrieden mit unserem ersten bescheidenen, aber besinnlichen Weihnachtsfest nahe am Äquator.
Heinrich Gockel ofm, ist Mitglied des Franziskaner-Ordens, lebte viele Jahre in Kenia, heute wohnt er in Dortmund.
Geburt unterm Tannenbaum
Nie habe ich mich so sehr auf Weihnachten gefreut wie damals, als ich schwanger war mit unserem dritten Kind. Im Mutterpass stand der 24.12. als berechneter Entbindungstermin. Im Sommer erzählte ich meinen kleinen Söhnen, dass wir zu Weihnachten diesmal ein Baby bekämen. Doch an dem lang ersehnten Datum ereignete sich: Nichts. Erst am Abend des zweiten Weihnachtstags setzten die Wehen ein. Wie schon bei unserem zweiten Kind hatten wir auch diesmal eine Hausgeburt geplant – mit unserer vertrauten Hebamme Gisèle. Sie legte mir einen Wehengürtel um den Bauch, stellte ihren Koffer neben die Krippe und den Wehenschreiber unter die Nordmanntanne. Im Laufe der Nacht schlängelte sich so eine lange Papierschlange mit den Kurven des Wehenschreibers unter dem Weihnachtsbaum.
Weil es dem Baby unter der Geburt nicht gut ging, rief die Hebamme gegen Mitternacht den Rettungswagen, um mit mir ins Krankenhaus zu fahren. Doch als der Wagen eintraf, hatten sich die Herztöne des Kindes wieder stabilisiert und die Presswehen schon eingesetzt. Mein Mann lief nach draußen zum Rettungswagen und bat den Fahrer, sich für den Notfall bereit zu halten. So saßen die zwei Sanitäter da draußen wie die Hirten auf dem Feld – und vernahmen wenig später die frohe Botschaft von der Geburt unserer Tochter. Kurz kamen sie ins Haus, um zu gratulieren und mit Sprudelwasser auf die Kleine anzustoßen. So wurde unsere Mirjam unter dem Tannenbaum geboren. Und auf ihrer Geburtsanzeige verkündeten wir ihre Ankunft mit dem alten Weihnachtslied »und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht«.
Eva-Maria Lerch, Wetzlar, war Redakteurin bei Publik-Forum.
Der Onkel kehrt heim
Oft habe ich damals meinen Vater nach seinem Bruder gefragt. Verschollen im Krieg. Darunter konnte ich mir als Kind nichts vorstellen. Irgendwo musste er doch sein. Immer wieder bestand ich darauf: Vielleicht kommt er noch. Vielleicht sucht er uns in Ostpreußen. Vielleicht kennt er unsere neue Adresse nicht. Regelmäßig hörten wir die Suchmeldungen des Deutschen Roten Kreuzes im Rundfunk. Die Stimmen der Radiosprechers habe ich heute noch im Ohr. Langsam und deutlich wurde ein Name nach dem anderen verlesen, jeden Tag. Mein Vater gab immer wieder eine neue Suchmeldung auf. Aber der Name, auf den wir warteten, fiel nie. Irgendwann, 15 Jahre nach dem Ende des Krieges, gab es für ihn keine Hoffnung mehr auf ein Wiedersehen. Verschollen. Nur ich fragte immer wieder nach. Und wenn er doch noch lebt? 1962 im Dezember, eine Woche vor Weihnachten, brachte der Briefträger Post vom Suchdienst des Roten Kreuzes. Keiner öffnete den Brief, niemand erwartete mehr eine Nachricht des Bruders. Erst am Abend öffnete meine Mutter das Kuvert, las den Briefbogen und reichte ihn an meinen Vater weiter. Die Eltern sahen sich mit großen Augen an, bei beiden begannen die Tränen zu laufen. Freudentränen. Eine Woche später war mein Onkel da. Ich konnte es gar nicht fassen, dass es plötzlich jemanden gab, der fast genauso aussah wie mein Vater. Er brachte seine Frau mit, von deren Existenz wir nichts geahnt hatten. Dieses Weihnachtsfest feierte die Familie wieder zusammen. Das war unser wunderbares Geschenk.
Ingelies Teichert lebt in Lüneburg, wo sie sich bei kirchlichen Andachten und als Kirchenführerin engagiert.
Schatten der Demenz
Heiligabend 2015: Wie jedes Jahr habe ich mich fein gemacht und schmücke den Christbaum. Da betritt meine Frau Barbara das Wohnzimmer und ist entsetzt: »Wer bist du denn? Was machst du in meiner Wohnung?« Ich antworte: »Aber ich bin’s doch, Wolfgang«, und versuche, sie zu umarmen. Sie weicht aus und fragt: »Wo bin ich hier?«
Ich bin geschockt, gehe ins Arbeitszimmer. Meine Gedanken kreisen. Weihnachten hatte meiner Frau immer viel bedeutet. Als Künstlerin hatte sie tolle Karten gemalt. Plötzlich fällt mir die Bemerkung ihrer besten Freundin ein. Barbara wirke in letzter Zeit oft zerstreut, irgendwie abwesend. Etwas zerstreut war sie immer, aber dass sie mich nicht mehr kennt, nach 31 Jahren Ehe?
Ratlos rufe ich unseren Sohn Christian an. »Oje«, sagt er. Er hat eine Idee, die einen Versuch wert ist: Ich bitte unsere befreundeten Nachbarn, Barbara zum Kaffee einzuladen. Und sie danach wieder nach Hause zu bringen – Betonung auf »nach Hause«. Und bitte keine Fragen. Zehn Minuten später klingelt es. Nachbarin Edith lädt Barbara zum Kaffee ein. Barbara mag Edith und geht gerne mit.
Ich ziehe wieder die Alltagskleidung vom Vormittag an, schmücke den Christbaum zu Ende, zünde die Kerzen an, schließe aber vorsichtshalber die Tür zum Wohnzimmer. Dann klingelt es. Edith hat Barbara im Arm: »Jetzt bist du wieder zu Hause bei Wolfgang«, sagt sie.
Ich führe beide erst in die vertraute Küche. »Dann wollen wir mal schauen, ob Wolfgang schon alles vorbereitet hat«, sagt Edith. Sie öffnet die Tür zum Wohnzimmer. Barbara zögert kurz, doch dann strahlt sie, als sie den geschmückten Christbaum und die leuchtenden Kerzen sieht. »Ich war nur schnell Kaffee trinken bei Edith«, sagt sie entschuldigend.
Danach ging alles seinen weihnachtlichen Gang. Geschenke, schön essen, Besuch bei Schwiegertochter und Sohn. Dennoch war alles anders. Ich achtete auf jede Reaktion von Barbara, ging am Morgen erst mit ihr in die vertraute Küche, bevor wir das Wohnzimmer betraten. Ein wertvoller Reflex, wie mir die Neurologin später erklärte, nachdem sie meine Frau eingehend untersucht hatte: »Ihre Frau wird sich verändern. Verändern Sie deshalb ihre vertraute Umgebung möglichst wenig.«
In den Jahren danach legten wir an Weihnachten nur ein paar Tannenzweige auf den Tisch. Rituale mögen heilsam sein, aber nur, wenn man in bestimmten Situationen über ihren Schatten springt.
Wolfgang Kessler, Wöllstadt, war Chefredakteur von Publik-Forum.
Nach dem Tod des Kindes
Unser Sohn Fabio starb vor acht Jahren an Krebs. Da war er zehn Jahre alt. Beim ersten Weihnachten nach seinem Tod standen wir wie unter Schock und haben alles so gemacht, wie immer. Es hat sich komisch angefühlt, aber es ging vorbei. Richtig schwer war das zweite Weihnachten ohne Fabio. Es hat keine Freude gemacht, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Es hatte keine Bedeutung mehr, eine Krippe aufzustellen und das Jesuskind hineinzusetzen, denn unser Kind war gestorben. Es fühlte sich an, als spielten wir uns gegenseitig ein Rollenspiel vor. Seitdem fahren wir über die Weihnachtstage zum Skifahren, fast immer in denselben Ort in Österreich. An Heiligabend gehen wir auf die Piste und abends zu einer Weihnachtsfeier mit Harfenspiel in ein Hotel. Weihnachten mit Schnee und etwas Festlichem, ohne dass es uns belastet – so ist es stimmig für uns.
Theresia Rosenberger ist Hebamme. Sie arbeitet im KinderPalliativTeam Südhessen, speziell im Team »Pränatale Palliativmedizin«. Es berät werdende Eltern, die wissen, dass ihr Kind vor, während oder kurz nach der Geburt sterben wird.
Coronakrank an Weihnachten
Am 24. Dezember 2021 war mein Coronatest positiv. Nur mit Mühe hatte ich mich am Vormittag zur Teststation geschleppt, Stäbchen in die Nase und schnell zurück ins Bett. Da lag ich nun mit Schüttelfrost und Gliederschmerzen, als die E-Mail vom Gesundheitsamt bestätigte: Corona positiv, die neue Omikron-Variante. Zu diesem Zeitpunkt bedeutete das 14 Tage Quarantäne, ohne Freitesten, keine Ausnahme. Dabei stand der gepackte Koffer doch schon in der Ecke! Aber an Heimfahren war jetzt nicht mehr zu denken und an »Weihnachten wie immer« schon gar nicht. Unter Tränen rief ich meine Familie an. 30 Minuten später machten sich Mama, Papa und meine beiden Brüder im Auto auf dem Weg zu mir – unzählige Dosen voller Essen im Gepäck. Wie praktisch, dass ich damals in einer kleinen Einliegerwohnung lebte, ebenerdig und mit einer überdachten Terrasse direkt vor meinem Fenster. Dort saß meine Familie, in dicke Winterjacken gehüllt, auf Gartenmöbeln. Sie tranken Punsch und aßen Plätzchen. Ich tat dasselbe – auf der anderen Seite des Fensters. Die Glasscheibe zwischen uns hat kaum gestört.
Später, als meine Familie wieder abgefahren war und ich müde auf dem Sofa lag, näherten sich plötzlich einige Lichtpunkte durch den Garten. Meine Nachbarn waren gekommen! Mit batteriebetriebenen Christbaumkerzen und einer langen Lichterkette, die sie in den Sträuchern vor meinem Fenster befestigten. Vor dieser funkelnden Kulisse begannen sie zu singen, ein Weihnachtslied ums andere. Mit gekipptem Fenster lauschte ich andächtig. Obwohl ich die einzige Person im Raum war, fühlte ich mich nicht einsam, denn meine Familie und meine Nachbarn hatten an mich gedacht. Und nicht nur das: Sie waren an mein Fenster gekommen, um bei mir zu sein – wenn das keine Weihnachtsbotschaft ist!
Mathea Willmann wohnt in Frankfurt am Main und ist Volontärin bei Publik-Forum.
Ein überraschender Gast
Seitdem meine alte Mutter nicht mehr alleine leben konnte, brauchte sie Hilfe. Viele Jahre lang, bis kurz vor ihrem Tod mit 98 Jahren, konnten wir mit häufig wechselnden liebenswerten osteuropäischen Frauen ihren Wunsch erfüllen, in ihrer vertrauten Umgebung in ihrem Haus versorgt und betreut zu werden. Sie wurde 1944 als Russlanddeutsche aus ihrer ukrainischen Heimat am Schwarzen Meer vertrieben und fand zusammen mit ihrem Mann im Rheinland eine neue Heimat, in der sie bis zu ihrem Tod bleiben wollte. Diesen Wunsch wollte ich ihr gerne erfüllen, da sie durch Flucht und Vertreibung traumatisiert war und nicht noch einmal ihre Heimat wechseln wollte und sollte.
An einem Weihnachtsabend war die Studentin Janina aus Moskau zu Besuch. Sie hatte zwei Jahre im Rahmen des Programms »Wohnen gegen Hilfe« bei meiner Mutter gelebt. Sie hatte darum gebeten, ihre russische Mutter Elena und den Freund aus Palästina mitbringen zu dürfen, damit sie mit uns zusammen einen deutschen Weihnachtsabend erleben konnten. Als aktuelle Betreuerin war Ana aus Rumänien da, die schon seit vier Jahren mit Unterbrechungen an der Seite meiner Mutter lebte und ihr eine gute Freundin geworden war. Ana hatte ihr Flugticket schon in der Tasche, wollte die Heimreise am 6. Januar antreten.
Als alle sieben Menschen am ausgezogenen Esstisch meiner Mutter zusammenrückten, war es zwar eng, aber gemütlich. Die Kerzen am Baum brannten, mein Mann las das Weihnachtsevangelium – als es klingelte. Draußen stand eine uns unbekannte Frau mit mehreren Koffern und sagte schwer verständlich etwas von »Hilfe für Oma und Opa von Organisation aus Moldawien«.
Ana und ich waren erstaunt. Die neue Pflegekraft sollte erst zwei Wochen später kommen. War das eine Verwechslung? Hier gab es keinen Opa, diese fremde Frau musste sich vertan haben. Aber die Adresse und der Name meiner Mutter, die sie uns auf einem Zettel zeigte, stimmten. Wir hatten nicht mit der neuen Betreuerin gerechnet, ihr Zimmer war nicht vorbereitet, sie kam ungelegen, wir erlebten es als Störung unseres Weihnachtsfestes. Entsprechend irritiert, vielleicht sogar ärgerlich muss ich ausgesehen und reagiert haben. Hinter der inzwischen etwas ängstlich gewordenen Frau aus Moldawien, die sich als Larissa vorstellte, tauchte nun ein junger Mann mit Kapuze auf, der seine Hand aufhielt und wiederholte: »Geld für Autofahrt, 100 Euro jetzt!« Eine skurrile Situation am Weihnachtsabend. Bis auf meine Mutter waren alle anderen Weihnachtsgäste inzwischen auch nach draußen gekommen, es wurde Russisch, Rumänisch und Deutsch durcheinander gesprochen.
Publik-Forum EDITION
»Das Ende des billigen Wohlstands«
Wege zu einer Wirtschaft, die nicht zerstört.»Hinter diesem Buch steckt mein Traum von einer Wirtschaft, die ohne Zerstörung auskommt. / mehr
Plötzlich fiel mir ein, dass mein Mann vor einigen Minuten die Weihnachtsgeschichte vorgelesen hatte, und ich musste in all dem Chaos lachen. Bethlehem also jetzt bei uns vor der Haustür!
Ich bezahlte den Fahrer und bat Larissa mit den Koffern herein. Sie setzte sich zu den anderen Gästen an den Tisch, wo inzwischen ein weiteres Gedeck aufgelegt worden war. Und jetzt? Da weitermachen, wo wir vor einer halben Stunde aufgehört hatten. Ohne Absprachen schienen sich alle daran halten zu wollen. Die bunt zusammengewürfelte Weihnachtsrunde begann von Neuem Weihnachtslieder zu singen, ein russisches sang Larissa laut und innig mit.
Sie hatte sich nichts dabei gedacht, direkt zu meiner Mutter zu fahren, als ihr von der vorherigen Familie vor Weihnachten einfach gekündigt worden war. Jetzt konnten wir uns einen Reim machen. Wir lachten und waren entspannt, der Abend nahm seinen guten Verlauf.
Meine Mutter war erschöpft, als sie zu Bett ging. Aber sie freute sich, dass sich alle so gut verstanden hatten. »In wie vielen Sprachen haben wir uns heute Abend eigentlich unterhalten und gesungen? Und wie viele Kulturen saßen bei mir friedlich am Tisch? War das nicht ein Weihnachtswunder?«, fragte meine Mutter. Glücklich schlief sie ein. »Spasibo za zemechatel´nyy vecher.« Danke für den schönen Abend – und das Weihnachtswunder.
Sigrid Tschöpe-Scheffler, Sundern, war Professorin für Erziehungswissenschaften an der Technischen Hochschule in Köln.
Das Schicksal der anderen
1972 war es, mein Vater war schon lange tot (als Folge des 2. Weltkrieges), meine Mutter war drei Jahre zuvor mit 59 Jahren gestorben. Alle Großeltern lebten nicht mehr, Geschwister hatte ich nicht. So stand ich allein und wohnte entsprechend als Jungmann von 24 Jahren im Elternhaus. Und dann »Jingle bells«? »Süßer die Glocken nicht klingen«? Nein, das war nicht möglich. Und dann der Vietnam-Krieg der Amerikaner mit den bekannt fürchterlichen Angriffen. Das bedeutete für mich, da ich ja ohnehin ganz allein war, dass ich nicht Weihnachten feiern konnte. Ich besorgte mir Plakate mit Aufschriften wie »Why?« und hängte sie im Wohnzimmer auf. Vielleicht habe ich eine Kerze angezündet. Das Leid der Vietnamesen (und aller Soldaten) ging mir näher als das eigene Schicksal.
Franz Maxwill lebt im Münsterland.
Weihnachten nach dem Krieg
Nach Schwürbitz, einem kleinen Ort in Oberfranken, kamen wir im März 1945: meine Mutter, meine Schwester und ich. Von Breslau hatte uns der Weg über Braunau im Sudetenland dorthin geführt. Wir waren Flüchtlinge, geflohen vor der anrückenden Roten Armee. Da ich erst vier Jahre alt war, weiß ich nicht mehr viel aus dieser Zeit. Aber an den Heiligen Abend 1945 erinnere ich mich detailliert. Am späten Vormittag des 24. Dezember kam der Pfarrer Zeltinger, ein großer, korpulenter Mann, keuchend und schnaufend in schwarzer Soutane die steile Treppe zu der kleinen Kammer herauf, in der wir wohnten. In den Händen hielt er eine Tüte mit Mehl und einen Klumpen Fett, eingepackt in grobes Papier. Er rief nach meiner Mutter und gab ihr Mehl und Fett. Meine Mutter zauberte daraus einen Kuchen. Das war unser Heiligabendessen, und ich weiß noch, dass es ein sehr schöner Abend wurde. Das Weihnachtsgeschenk des Pfarrers, vor allem sein Besuch bei uns armen Flüchtlingen, hat wohl meinen allmählich sich entwickelnden Geist geöffnet für die Annahme der christlichen Lehre und des christlichen Glaubens und die ganze damit verbundene Schönheit christlich-abendländischer Kultur.
Wolfgang Paul, geboren 1940 in Breslau, lebe seit 50 Jahren in Darmstadt und war dort als Psychologischer Psychotherapeut tätig.
Zweimal Corona-Weihnachten
2020. Corona-Kontaktbeschränkungen: Keine Aufregung wegen der Organisation des Krippenspiels. Keine Fragen »Wer trifft sich wann mit wem und wo?« Das erste Mal Weihnachten nur mit der eigenen Kernfamilie und nur zu Hause: Weihnachtslieder-Singen zu viert, Gesellschaftsspiele, Fernsehen, Faulenzen. Die Krippe unter dem leuchtenden Tannenbaum kündete von der Geburt Jesu. Geschenke wurden erst am zweiten Feiertag ausgepackt. Wir hatten keine Eile.
2022. Die Krippenfeier war gelungen, obwohl ich kurzfristig für unsere plötzlich kränkelnde Tochter die Erzählerrolle übernehmen musste. Die selbst gebackenen Pizzastangen und der Nachtisch für das anschließende traditionelle Treffen mit dem Schwager und seiner Familie standen bereit. Noch schnell zur Sicherheit ein Corona-Test: Ein zweiter blasser Strich bei unserer Tochter! Sie zog sich in die Isolation ihres Zimmers zurück. Unser Sohn und seine Freundin verließen fluchtartig das Haus. Am nächsten Tag legte sich auch mein Mann ins Bett. Unvermeidbare Kontakte gab es nur noch mit FFP 2 – Masken. Ich kämpfte allein mit dem Berg aus Pizzastangen. Aber im Hintergrund erinnerte die Krippe unter dem geschmückten Tannenbaum an die Geburt des Sohnes Gottes.
Hildegard May lebt in Rheda-Wiedenbrück.
Der Ziehsohn an der Tür
Etwa 13 Jahre war ich. Die Familie sang Stille Nacht, der Weihnachtsbaum leuchtete, die Geschenke waren verteilt - als es an der Tür klingelte. Wer konnte das sein? »Helmut« sagte jemand, es klang erschrocken. Ich lief zur Tür. Aus Erzählungen wusste ich: Meine Eltern hatten ihn an der Autobahn aufgelesen, als er mit zwölf Jahren aus dem Heim abgehauen war. Sie hatten versucht, ihm zu helfen. Oft verbrachte er die Ferien bei uns. Letztlich konnten sie aber nicht verhindern, dass er in Drogensucht und Beschaffungskriminalität abrutschte. Jetzt stand er vor uns. Er sei gerade aus der Haft entlassen, stammelte er. Ich würde gern erzählen, dass wir ihn hereingebeten hätten. Aber das haben meine Eltern nicht getan, auch aus der Sorge, so viel »heile Welt« würde ihn eher frustrieren als ihm helfen. Sie packten stattdessen Tüten voll mit Lebensmitteln, mein Vater fuhr Helmut in seine Wohnung. Nichts außer einer Matratze sei darin gewesen. Auch danach kümmerten sie sich, halfen bei der Suche nach einer Lehrstelle. Doch nach und nach ebbte der Kontakt zu Helmut ab. Dieser Heilige Abend hat mir gezeigt: Manchmal kann auch Zuwendung einen Menschen nicht einfach so retten.
Constantin Wißmann ist Redakteur bei Publik-Forum.
Weihnachten allein
So wollte ich diese Nacht nicht verbringen. Allein in der großen Dienstwohnung. Die Scheidung war vor drei Monaten. Die Mutter musste mit den vier Kindern, 7, 6, 6 und 2 ausziehen.
Wie verbringen wohl Randständigen den Weihnachtsabend im Niederdorf von Zürich? fragte ich mich. Nun streifte ich durch die Gassen der Altstadt. Der kalte Wind war in der diesigen Nacht gut zu spüren. Nur wenig Menschen begegneten mir. Geschäfte, Imbissbuden, die meisten Gaststätten, sogar Nachtlokale und Bars waren geschlossen. Dann, aus einer Gaststätte kam Licht und davor stand eine Tafel: »Als Dank an unsere Gäste von diesem Jahr: GRATIS ein heisser Schüblig, Kartoffelsalat, Brot und ein Kübel Bier. Frohe Weihnachten.«
Diese Einladung nahm ich dankbar an, da ich noch nicht gegessen hatte. Einige Gäste saßen zusammen, aßen und tranken. Wie sollte ich mich jetzt – so fremd – verhalten? Ich setzte mich an einen Tisch, ließ mich bedienen und beobachtete das Geschehen. Dann bedankte ich mich scheu und verließ nachdenklich das Lokal.
Jetzt war es Zeit für die Mitternachts-Feier im Grossmünster. Die Kirche war schon sehr gefüllt. Ein Platz wurde mir angewiesen. Der Gottesdienst begann mit Glockengeläut, Orgelmusik, Weihnachtslieder, Lesung der Weihnachtsgeschichte, und einer Predigt die mich maßlos enttäuschte. So viele Menschen sind mal wieder versammelt und da höre ich nichts was mich anspricht, Mut macht, tröstet. So ganz anders als in der Beiz vorhin.
Aufgekratzt lief ich die 30 Minuten nach Hause. Setzte mich hin und schrieb meine eigene Weihnachtspredigt – ganz für mich allein:
»Was denn, möchte für mich, für dich, für uns alle, ein Stern sein, den wir wählen könnten – nicht um ihn zu ergreifen – sondern dass er uns aufleuchten, uns locken, leiten, ziehen würde, hin zu dem Kind – in uns selbst, im andern – verborgen, verkannt, vergessen, dass wir dieses Kind mit all unsern Sinnen erfassten, ehrten, schützten, kraftvoll mit allen verfügbaren Ressourcen förderten – dieses Kind, das da heißt: Friede und Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit – damit es leben möchte, um groß und stark zu werden? Ganz anders, wie Hirten und Weise, würden wir aus der Geschichte hervorgehen und so, mit einem köstlichen Lachen zur Vollendung der Schöpfung Gottes beitrügen. Der Gruß des Engels würde wahr: Fürchtet euch nicht weiter in dieser Welt! Freuet euch!«
Johannes Heinrich wohnt in Pfäffikon in der Schweiz.
Weihnachten gemeinsam
Bei uns heißt es seit 2023 »Weihnachten gemeinsam«. Ich bin Mitglied im katholischen Kirchengemeinderat in Tettnang und ich hatte die Idee dafür. Am 24.12. bieten wir an, Weihnachten gemeinsam mit Menschen der Stadt zu feiern, die ansonsten einsam und alleine wären. Mein Mann (evangelisch) und ich kochen ein einfaches Gericht und die Besucher können etwas mitbringen: ein Gedicht, ein Musikinstrument, ein Lied, eine Geschichte, Leckereien oder ähnliches. Niemand muss sich vorher anmelden und da wir kein Programm anbieten, entwickelt sich der Abend spontan. Letztes Jahr waren wir 10 Personen. Wir hatten einen schönen Heiligabend.
Monika Jonat und Frank Jonat leben in Tettnang.
Im Hochland von Peru
Als Gemeindeleiterin von 30 Gemeinden im Hochland von Peru verbringe ich den Heiligen Abend mit Nachbarn und vielen Landbewohnern gemeinsam im Tempel. So nennen wir unsere Kirche. Während einer ausgedehnten, vier- bis fünfstündigen Liturgie mit Liedern, Theatern, Tänzen, reichen wir auch einen Kaffee und zwei frischgebackene trockene Brote für jeden. Alle aktiven Gruppen des Dorfes und des nahen Land-Umkreises beteiligen sich am Kaffee und am Programm. Um Mitternacht erlaube ich mir zum besonderen Anlass eine Festtagspredigt:
»Hermanos Campesinos, (Brüder und Schwestern Indigenas) in dieser Nacht danke ich euch dafür, dass ihr mir gezeigt habt, was Weihnachten ist. Das Wichtigste ist das Kind. Ihr habt dieses Fest befreit vom Ballast, den ich aus meinem Heimatland kenne und auch aus den Städten Perus. Dort werden zwar bis heute echte Anstrengungen unternommen, den Gottesdienst zum Mittelpunkt zu machen. Doch will es nicht gelingen, weil die Tische zu Hause sich unter den Geschenken biegen, zu einem zweiten, nachträglichen Fest laden und ablenken vom eigentlichen Weihnachtsgeschehen. Alle Welt lechzt in dieser Nacht nach dem Besonderen, aber nicht nach dem Einzigen. Bei euch hier ist es anders. Das Fest findet statt ohne Klimbim, ohne Weihnachtsbaum, ohne Fleischtöpfe und Christstollen, wenn die Propaganda im Radio auch noch so laut davon dröhnt. Ihr habt mich gelehrt, auch so froh zu sein. Deshalb bin nicht ich es, die euch heute Seine Frohe Botschaft verkündet, ihr habt sie mir schon längst gebracht. Wir feiern ein Fest, hier vor der Krippe, von euch liebevoll gerichtet, wie auch das Programm rund um das Kind. Niemand von uns wird nach dem Kommunionmahl und der kleinen Weihnachtsagape in sein Haus zurückkehren, um dort ein anderes Fest zu beginnen. Ihr werdet nicht bei Kerzenschein vor Geschenktischen sitzen. Ihr habt nicht einmal Tische oder Kerzen. Deshalb seid ihr frei, frei auf wunderbare Weise, Gottes Botschaft, die er für die Armen bereithält, heute Nacht anzunehmen: »DIE BOTSCHAFT FÜR DAS LEBEN«. Das heißt nicht, dass wir ohne Schuld wären, weil wir arm sind. Doch es heißt, dass wir die herrliche Chance der offenen Ohren und Hände in dieser Nacht nutzen können, damit Gott als ein Kind wirklich bei uns einkehrt.
Nutzen wir auch die Freude der beiden Festtage, um Kraft zu schöpfen für unseren Alltag, der immer wieder so rau von Herodes durchkreuzt wird. Er hält weiterhin seine Massaker auf unserem Kontinent. Auch auf subtile Art versucht er das Kind zu verletzen, wo er kann, weil es ihn bedroht, mit der unerwünschten Möglichkeit, in seinen Machtbereich einzudringen. Deshalb steht an unserer Krippe auch ein Kreuz, um uns zu erinnern, was wir in diesem neugeborenen König feiern: den Kampf für das Leben und die Auferstehung.«
Christy Orzeschowski, Aschendorf, lebte und arbeitete von 1976 bis 2003 im peruanische Hochland auf mehr als 4000 Metern Höhe als Gemeindeleiterin von 30 Landgemeinden.
Weihnachten mit französischen Rekruten
Jedes Jahr organisierte die lokale Badische Zeitung, dass französische Rekruten an Heiligabend von Familien eingeladen wurden. So hatten auch wir gelegentlich zwei fremde junge Männer auf dem Sofa sitzen. An drei dieser Begegnungen erinnere ich mich besonders: Einer der Soldaten erzählte, dass er von Freiburg zum ersten Mal im Deutschunterricht gehört hatte. In den Lektionen seines Deutschbuchs gab es eine Familie, die zu den französischen Militärangehörigen in Freiburg gehörte. Ein anderer Gast war schon etwas älter. Er war Lastwagenfahrer und hatte eine Zeit lang bei einer Spedition in der westfälischen Heimat unserer Mutter gearbeitet. Trotzdem war das Gespräch mit ihm angespannt, denn er hatte sich als Atheist und Kommunist zu erkennen gegeben, was meine Eltern keineswegs begeisterte. Schließlich lernten wir auch einen jungen Mann aus Neukaledonien kennen, einer zu Frankreich gehörenden Inselgruppe im Südpazifik. Mit ihm hatte ich anschließend noch eine Weile Briefkontakt. Im Nachhinein bin ich meinen Eltern dankbar, dass wir diese Form der Gastfreundschaft kennen lernen durften. Und diese Erfahrungen haben sicher auch dazu beigetragen, dass ich während meines Studiums zwei Semester in Paris verbracht habe.
Clemens Bühler lebt in Sasbach.