Arrest für die ganze Corona?
Heute, am 26. März, habe ich wieder meine ältere Schwester in ihrem Freiburger Senioren-Wohnheim besucht, das nun wegen der jetzigen Infektionsgefahren ersten strengen Auflagen unterworfen ist. Seit einer Woche darf nur noch eine Person der Angehörigen das Haus betreten und dann auch nur für eine Stunde. Da sie schon sehr vergeßlich ist, ist ihr der Ernst dieser Lage bisher nicht bewußt geworden. Zynisch fast, welche Gnade ihr die eigene Demenz dabei erweist. Nach etlichem vergeblichen Klingeln bei ihr und Klopfen an der Haustür öffnete mir schließlich die Seniorenbetreuerin und ich gelangte zur Wohnung: »Hallo, Margret. Wie geht‘s?« – »Ha, gut! Was willsch denn du?« – »Spaziere gehen mit dir!« – »Ja, aber ich bin ja noch im Schlafanzug«, sagte sie erst abwehrend. Dann verschwand sie aber kurz entschlossen im Badezimmer. Ich schaute mich derweil in der Ein-Zimmerwohnung um. Ich hatte Chaos und Anzeichen von Verwahrlosung durch das ständige Eingeschlossensein seit einer ganzen Woche vermutet. Nichts da, sie hatte ihr Bett gemacht und auch etwas aufgeräumt. Sie war guter Dinge, als wir mit dem Aufzug hinunter fuhren und nach zwei Straßen in die große Einkaufsmeile im Stadtteil einbogen. Wunderbar beschien die Frühlingssonne unsere ersten hundert Schritte. Dann wollte sie auf die andere, etwas schattigere Straßenseite wechseln, was mich verwunderte.
»Kumm, jetz trinke mer Eins«, schlug sie vor, denn sie hatte von weitem den »Italiener«, ihr Lieblings-Restaurant, entdeckt. »Die haben zu! Alle Wirtschafte un Cafés sin seit einer Woch gschlosse!«, sagte ich, als wir schließlich vorm »Italiener« standen. Dann sah sie im Lokal die aufgestapelten Stühle, die zusammen geschobenen Tische, und daß überhaupt kein Licht drinnen brannte. Sie konnte es nicht glauben. »Habbe die heut Ruhetag?« – »Schön wär‘s. – »Komm, dann gehen mer auf d‘Straßebahn un fahre in d‘Schdadt nei!« .- »‘S gibt nirgends was zu trinke, in ganz Freiburg nit!«, sagte ich laut. »Au in dr Markthalle nit?« Sie schaute verdutzt. – »Nix hat offe! Alles wegge dem Virus! Der geht momentan in d‘ ganz Welt rum!«, sagte ich noch lauter. – »Ha, dess isch jo e Kataschdroph!« – »Das kannsch ganz laut saage!« Wir trotteten weiter. Dann zog sie ihr Tempo an. Ich vermutete, daß sie das nächste Gasthaus ansteuern würde. Richtig. Sie hatte bereits wieder vergessen, warum beim »Italiener« nicht offen war.
Am 30. März habe ich am Vormittag bei der Zeitungslektüre versucht, mir die Corona-Zahlen zu merken. Waren es in Freiburg 50 Ansteckungen, wieviel im Kreis Emmendingen, ja und wieviel in ganz Deutschland? Italien hat schon über 10 000. Und Spanien, Schweden, die USA? Und weltweit? Und dann noch die Todeszahlen? Unfassbar für mein Gedächtnis, das von der Zeitungslektüre morgens bis zu den Abend-Nachrichten zu behalten.
Mann, es ist das schönste Frühlingswetter heute, am 31. März, und weit und breit kein Café mit schönen Sitzplätzen im Freien hat offen. Keine Gartenwirtschaft darf Gäste unter seine stattlichen Kastanienbäume einladen, dank »Corona«. Ein großer Jammer. Tiefe Melancholie. Wo früher fröhliche Menschengesichter der Sonne entgegenstrahlten, blinzeln heute ein paar Einzelne, schon mit einem Mundschutz gesichert, über ihn hinweg und machen auch noch einen großen Bogen um einen herum.
An diesem ominösen Tag, dem 1. April, ist kaum jemandem zum Scherzen zumute, mir schon gar nicht. Im Gegenteil: Die sonst tägliche Flut an Mails, seriöse, angenehme, störende, alles ist zum dünnen Rinnsal verkommen. Als wäre ich selbst auch schon unter den Corona-Toten. Nur noch läppische Werbemails. Ich muss einfach selbst mal wieder eine Rundmail starten, mit einem eigenen »Lebenszeichen«, sage ich mir, ja, coronaspezifisch. Gleich am Abend habe ich an die ersten 100 Mailadressen meine letzte Geschichte der Jahresschreibwerkstatt geleitet – mit dem schönen Bild unseres primelübersäten Vorgartens. Herrliche berührende Dankesmails landen noch spätabends im Postfach und viele weitere die nächsten Tage.
Immer noch saukalt am Morgen, nicht einmal Null Grad an diesem 3. April. Aber mittags steigt das Thermometer auf wohlige 15 Grad. Sehr extrem. Die Frühlingsblumen im Garten und auf der Terrasse drücken heraus und – leiden sichtbar. Ich leide auch, aber eher unter diesen »Haftbedingungen«, die ganz offiziell über uns verhängt sind.
Wie erlebt das wohl meine Schwester im Wohnheim? Die Vorschriften wurden in der Karwoche verschärft: Kein Ausgang mehr! Sie, die Redselige, bekommt seit Tagen keine anderen Bewohner mehr zu Gesicht. Alle gehören zur »Risikogruppe« und müssen in ihren Wohnungen bleiben und dürfen nur noch in Ausnahmefällen durch den Hinterausgang hinaus. Jede/r erhält 3x täglich die Mahlzeiten aufs Zimmer. Der Haupteingang der »Residenz« bleibt geschlossen, bei Anruf der Telefonnummer kommt jemand vom Büro und bestätigt: »Jawohl. Wohnheim und Pflegeheim geschlossen wegen Corona.« Nichts mehr mit Zusammensitzen der alten Leute weder zur Mahlzeit im Speisesaal noch später ungezwungen im Foyer. Auch draußen auf einer Bank nicht. Kein Plausch mehr am Hauseingang mit Angestellten oder Besuchern. Alle Gemeinschaftsangebote sind gecancelt. An den Ausgangstüren sind Desinfektionssprayer mit dem Zeichen der sich reibenden Hände angebracht. Die Betreuerin kündigt an ihrer Bürotür an, daß sie ab übermorgen im Osterurlaub sei. Damit fällt die Stimmung der Bewohner auf den Nullpunkt, wie sie mir später gesteht.
Gestern, am 7. April, war ich vier Stunden am Kaiserstuhl in der Kaffeerösterei meines Neffen und habe ausgeholfen. Von Arbeitsmangel oder Umsatzeinbruch war hier nichts zu spüren. Wegen Corona hat er pro Tag zwei Arbeitsschichten à drei Personen eingeteilt. Kein Team kommt so mit dem anderen in »Berührung«. Erkrankt jemand von einem Team, würde das ganze gesperrt und das andere Team müsste dann ganztags arbeiten.
Publik-Forum EDITION
»Das Ende des billigen Wohlstands«
Wege zu einer Wirtschaft, die nicht zerstört.»Hinter diesem Buch steckt mein Traum von einer Wirtschaft, die ohne Zerstörung auskommt. / mehr
Am Abend dieses 8. April gerate ich in eine »Endzeit«-Stimmung. Ich befürchte, jederzeit irgendwo angesteckt zu werden und in ein paar Tagen läge ich mit Atemnot auf der Intensivstation. Wilde Alpträume in der Nacht.
An diesem Gründonnerstag 9. April, auf der Zugfahrt nach Freiburg zum Optiker beschleicht mich ein dumpfes Gefühl. Es könnte zu spät sein, daß ich meinen jüngeren Sohn überhaupt noch einmal zu sehen bekomme. Ich schreibe ihm sofort eine SMS: Morgen, Karfreitag zwischen 13 und 15 Uhr möchte ich dich besuchen und dir – nach drei Monaten! – endlich dein Weihnachtsgeschenk übergeben, ja? Ich weiß, alle Kneipen sind auch in Stuttgart zu. Irgendwo in einem Vorort oder auf halber Strecke im Nordschwarzwald, o.k.? – »Oh, nein, Vadder«, krächzt er beim sofortigen Rückruf ins Handy, »ich bin seit drei Tagen schlimm erkältet: Husten, Kopfweh, Schlappheit, das ganze Programm« – »Oha«, frage ich zögernd, »bist du schon beim Arzt gewesen und auf »Corona« getestet?« – »Nein«. Er glaubt nicht, daß es nötig ist. »Nur eine einfache Grippe« – »Wirklich ?….Du, ich muss jetzt umsteigen und losrennen, damit ich den Anschlußzug erreiche. Mein Zug hatte mal wieder Verspätung. Tschüss!« Mit noch bangerem Gefühl fahre ich weiter. Zehn Minuten zu spät stehe ich vor der Ladentür meines Optikers, der wegen »Corona« nur in Notbesetzung da ist und begrenzt offen hat. Endlich, nach langen Klopfen öffnet mir doch noch eine Mitarbeiterin und ich erhalte meine neue Brille: Klare Sicht wieder für die Augen und neues Gestell auf der Nase. Als ich um neun Uhr abends, wie vereinbart, zur Fortsetzung des Telefongesprächs in Stuttgart anrufe, springt nur Tills AB an. Was? Nicht zu Haus? Aber er ist doch krank? Ich gehe ratlos in meinem Zimmer auf und ab. Vielleicht ist mittlerweile der Notarzt gekommen und hat ihn gleich ins Krankenhaus eingewiesen. Schlimmste Befürchtungen. Kurz vor Mitternacht kommt der Rückruf, er habe um Neun bereits geschlafen und jetzt meinen vergeblichen und besorgten Anruf abgehört: »Fahr nicht morgen! Das wäre auch für dich nicht gut! Bist ja auch »Risikogruppe«. Du wärst runde sechs Stunden wegen deines Weihnachtsgeschenks für mich unterwegs. Ich fühle, daß es mir immer besser geht. Ich bin nicht coronakrank, eine Grippe eben. Warten wir doch bis nach Ostern.« Dann haben wir fast eine Stunde miteinander telefoniert, so wie seit Jahren nicht mehr. Er hat meine Panik verstanden und einen Meinungswandel bei mir eingeleitet. Er gab mir dann noch die Handy-Nummer seiner Freundin und Mitbewohnerin. »«Aber nur wegen deiner derzeitigen Endzeit-Stimmung willst du die haben?«, fragte er etwas mißtrauisch. – » Ja, klar! Danke, danke!« Ich legte beruhigt auf.
Dienstag nach Ostern, 14. April: Im gestrigen Telefonat mit ihm habe ich gefragt, wie lange er denn schon krank sei. Bei »Corona« sei das ein wichtiger Indikator. Er erschrak und rechnete nach: Richtig, 1, 2 Tage nachdem er Mitte März aus Berlin zurückgekommen sei, habe es angefangen und sei in Schüben gekommen und gegangen. »Also vor fast drei Wochen«, sagte ich. »Das ist ernst. Du musst morgen sofort das Gesundheitsamt anrufen und deine Symptome abfragen und bewerten lassen!« Er verstummte. Das schien ihm einzuleuchten.
Mittwoch, 15. April: Nein, er habe sich keinen Test-Termin geben lassen. Es gehe wirklich aufwärts. Aber mit seinem Bruder Joachim in Berlin habe er lange telefoniert und ihm wohl auch von meiner »Endzeitstimmung« erzählt. Und wie gerne ich auch die Berliner Enkelkinder wieder sehen würde. Was bei meinen Telefonaten mit dem vierjährigen Enkel das besondere Problem für mich bleibt: Ich verstehe seine hohe Kinderstimme sauschlecht, sein aufgeregtes Haspeln mit den Sätzen. Ich bin dann so hilflos und der Kleine weiß gar nicht warum. So sei den beiden Söhnen die Idee gekommen, mir ein Tablet zu schenken, mit dem ich »Skypen« könne, also »Telefonieren mit Bild«. Er konnte mir diesen überwältigenden Effekt sofort mithilfe des mit Skype ausgestatteten Smartphones meiner Wohngenossin vorstellen. Ich war perplex: Mit Handy ihn virtuell durch meine ihm unbekannte Wohnung zu führen und dabei mit ihm zu reden, zu lachen, zu sehen, zu staunen. »Vadder, wir haben dir so ein Tablet bestellt. Ich bereite alles für deinen Gebrauch vor. Dann fahre ich zu dir nach Waldkirch, richte es ein und zeige, wie alles funktioniert!« Was für eine wunderbare Aussicht, aus meinem »scheinbar« kommunikationstechnischen Jammertale, nur mit Handy, Internetzugang und E-Mail ausgestattet zu sein, herauszukommen, schwärmte ich. Meine Wohngenossin und ich begannen, für den seltenen, ja seinen ersten Besuch ein schönes Mittagessen zu planen.
Freitag nach Ostern, 17. April: Es ist halbfünf Uhr morgens und noch dunkel. Ich wache mit der drängenden Frage auf: Wenn ich zu Hause sterben darf, in welchem Zimmer dann am liebsten? In einem zur Straße hin oder im Gästezimmer mit dem Bad daneben oder in meinem eigenen Zimmer mit dem Blick in die vielen Gärten? Welche praktischen Überlegungen pflegerischer Art muss man anstellen? Gedanken schießen zu diesem Thema hin und her. Die sind nicht unnötig oder abwegig bei meinen 74 Jahren. Ja, die ganze Corona steht doch kopf! Alle.
Aber beim Frühstück dann fällt mir wieder das Telefonat mit dem Sohnemann ein und seine Ankündigung: Am Montag komme ich! Auf zwei Uhr. Recht so? Neue Freiheiten mit Tablet und Skype.
______
Alle Beiträge des Erzählprojektes »Die Liebe in Zeiten von Corona«
______
Jeden Morgen kostenlos per E-Mail: Spiritletter von Publik-Forum
Dies ist ein Beitrag im Rahmen des Erzählprojektes von Publik-Forum »Die Liebe in Zeiten von Corona«. Wir laden unsere Leserinnen und Leser ein zu unserem Erzählprojekt: Bitte schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen, Nöte, Ängste und Ihre Zuversicht in Zeiten von Corona.



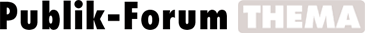
 Die Liebe in Zeiten von Corona
Die Liebe in Zeiten von Corona

